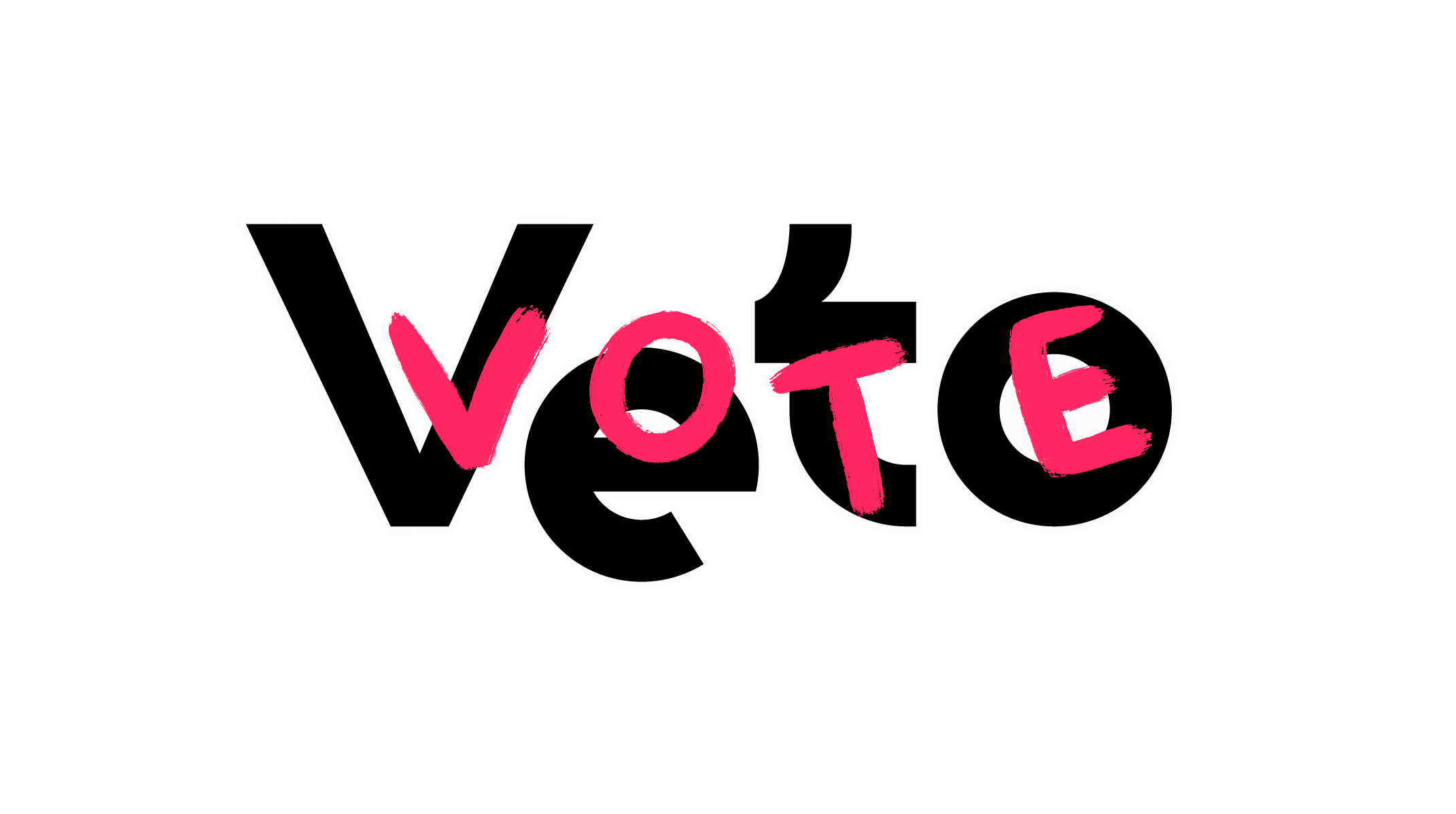Im Osten was Neues?
Nach den Anti-AfD-Protesten haben sich auf dem Land, in Klein- und Großstädten neue Bündnisse gegen rechts gegründet. Etablierte Initiativen kämpfen hingegen seit Jahren. Was begrüßen, was kritisieren sie an der neuen Solidaritätswelle?

Sachsen: Der reale Klimawandel
Die Springerstiefel und Bomberjacken sind zurück. Davon ist Doro Schneider überzeugt. Sie beobachtet, dass junge Leute im ländlichen Raum heute wieder sehr selbstbewusst klarmachten, dass sie weder bürgerlich noch anschlussfähig seien – sondern wie früher: rechts. Und da ist noch mehr, was im sächsischen Zittau aktuell an Nuller- und Neunzigerjahre erinnert.
Doro Schneider erzählt von Einschüchterungsversuchen gegenüber marginalisierten Gruppen und aktivistisch Engagierten. Von wachsenden Angsträumen und handfester Gewalt in der 25 000-Seelen-Stadt. Würde sie ihre subjektiven Erfahrungen auf einen Post zusammenkürzen, wie es so viele Menschen seit Jahren unter dem Hashtag Baseballschlägerjahre auf Social Media tun, könnte sich das in etwa so lesen:
Geschrieben hätte sie diese Posts 2024, nicht vor 20 oder 30 Jahren. Denn Doro Schneider erlebt diese Dinge aus nächster Nähe – als Vorständin des Vereins Augen auf, der sich seit 2004 in Sachsens Dreiländereck engagiert. In dieser Funktion leistet sie Bildungsarbeit und macht sich für Demokratie stark. Dazu gehören Fußballturniere und Kulturveranstaltungen, Workshops an Schulen. Zuletzt hat sie auf Bundesinitiative hin in der Wanderausstellung „Toleranzräume“ den Dialog zur Bürgerschaft gesucht. Mit ihren etlichen Aufgaben in der Öffentlichkeit gilt sie vielen als prägendes Gesicht des Anti-rechts-Engagements in Zittau. Und das hat Folgen.
Ihr Zuhause wurde fotografiert, ihre Adresse im Netz veröffentlicht, Reifen am Auto zerstochen. Weil sie Interviews gibt und versucht, Sachsen und Rechtsextremismus zu erklären; weil sie zur rechten Szene recherchiert und Vorträge hält; weil sie Bündnisse wie „Zittau ist bunt“ ins Leben ruft und Demonstrationen anmeldet, um ein anderes Bild der Stadt zu zeichnen, in der jeden Montag seit Corona – wie vielerorts im Land – Menschen „gegen die da oben“ auf die Straße gehen.

Ihre Motivation hat dabei nicht viel mit der bundesweiten Dynamik und Solidarisierung zu tun. „Mich haben einfach Jugendliche angesprochen“, erzählt sie. „Sie meinten schon vor den Aktionen überall im Land: Wir wollen ein Zeichen setzen!’“ Gegen Rassismus, für ein Miteinander und Akzeptanz. Da habe sie nicht lange gezögert und eine erste Kundgebung angemeldet.
Es gehe bei den Veranstaltungen weniger darum, die bislang stille Mitte zu erreichen oder neue Allianzen zu schmieden. „Für mich ist entscheidend, dass junge Menschen empowert und unterstützt werden. Dass sie das Selbstbewusstsein bekommen, ihre Stimme einzusetzen und ihre Meinung zu äußern.“ Was Doro Schneider daher beflügele, sei weniger der Fakt, dass auf den Zittauer Demos zuletzt bis zu 200 Menschen für die demokratische, antifaschistische Sache eingetreten sind.
„Es berührt und bestärkt mich vielmehr, dass mir junge Menschen sagen, wie wertvoll es für sie ist, dass die Stadt für kurze Zeit kein Angstraum mehr ist.“
Etablierte rechte Strukturen, Politikverdrossenheit und daran anknüpfend hohe Zustimmungswerte für die AfD, sagt Doro Schneider, könnten nicht mehr durch punktuell neu entstehende Allianzen gekippt werden. Der Klimawandel von rechts sei längst real und auch gefestigt, Netzwerke gut organisiert und die Zahl politisch motivierter Straftaten im Aufwärtstrend.
Das Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung hat 2021 darauf hingewiesen, dass die Erfahrung zweier diktatorischer Vergangenheiten sowie komplexe Transformationsfolgen im Zuge der Wiedervereinigung einen Nährboden für die Hinwendung zu politischen Rändern bereitet hätten. Natürlich gilt das im Osten über Regionalgrenzen hinaus.
In Sachsen zeige sich keine gesteigerte Nähe zu rechtsextremistischen Aussagen. Nationalistische und chauvinistische Einstellungen seien aber weit verbreitet. Und: „Eine sächsische Auffälligkeit stellt die besonders starke Ablehnung von Kompromissen dar.“
Zudem erwachse aus rechtsextremen Einstellungen überdurchschnittlich häufig rechtsextremes Verhalten. Und rechtsextreme Bewegungen wie Parteien erführen besonders viel Zustimmung. Für Doro Schneider sind es vor allem zwei Dinge, die diese Entwicklung gefördert haben.


Zum einen sei vielfach vergessen worden, unmissverständlich rote Linien zu ziehen. Zu oft habe der Widerspruch gegen rechts gefehlt, zu oft seien keine Grenzen gezogen worden. Stattdessen habe der Dialog mit rechten Kräften im Fokus politischer Arbeit und politischer Bildungsangebote gestanden. Sie nennt dafür ein Beispiel, das bundesweit Aufmerksamkeit erzeugt hat: Im März 2023 stürmten Demonstrierende aus dem Umfeld der rechtsextremen Partei Freie Sachsen eine Stadtratssitzung in Zittau. Sie hatten zuvor gegen die Einrichtung einer Asylunterkunft im Ortsteil Hirschfelde protestiert.
„Erstens“, fragt Doro Schneider: „Was sind das für Mittel? Und zweitens: Warum geht der Bürgermeister im Anschluss trotzdem zu diesen Menschen vor die Tür? Er kam ja gar nicht zu Wort, weil die Leute ihn niedergeschrien haben. Weil gar kein Interesse bestand, sich auseinanderzusetzen.“
Und sie erinnert sich noch an einen anderen Vorfall: „Eine Diskussionsrunde zwischen Kommunalpolitik und Bürgerschaft. Im Saal ruft jemand: ,Der Bürgermeister gehört verhaftet für die Corona-Maßnahmen.’ Und der Bürgermeister sitzt mit im Raum und niemand, nicht mal die Moderation, schreitet ein. Dabei muss das doch das Mindeste sein.“ Schulterzuckende Akzeptanz hätte so eine Kultur der Grenzüberschreitung normalisiert.

Zum anderen kritisiert Doro Schneider die fehlende Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit dem Konzept akzeptierender Sozialarbeit. In Zittau sei aus genau diesem Ansatz heraus Anfang der Neunziger der Nationale Jugendblock (NJB) erwachsen, den der jüngste Verfassungsschutzbericht als essenziellen Teil der subkulturell rechtsextremistischen Szene definiert.
Rechten Jugendlichen wurden in den Wirren der Wiedervereinigung proaktiv Räume zur Verfügung gestellt, Sozialarbeitende haben sie dabei unterstützt, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. „Das Resultat ist, dass wir seit über 30 Jahren eine etablierte, professionalisierte rechte Struktur, eine Kameradschaft in der Stadt haben, die nach wie vor ein Haus besitzt.“ Nicht nur in Zittau sei das Teil rechtsextremer Organisierung. „Das Konzept akzeptierender Jugendarbeit hat auch Netzwerken wie dem NSU geholfen, eine gewisse Stärke zu erlangen“, erklärt Doro Schneider und verweist auf eine Auseinandersetzung dazu im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss.
Die Konsequenz sei, dass Rechte heute voller Selbstvertrauen auftreten und vor allem auch über Orte der Jugendkultur bestimmen. „Alternativen jungen Menschen, Leuten aus der queeren Community, migrantischen Menschen fehlen die Anlaufpunkte. Jugendclubs im ländlichen Raum sind für sie keine Rückzugsorte mehr, weil entweder Nazi-Mucke läuft und sich Anwesende teilweise mit Hitlergruß begrüßen. Oder sie können aus Sicherheitsgründen gar nicht rein, weil sie sofort aufs Maul kriegen würden.“
Thüringen: Gegen- und Durchhalten

Über dem Marktplatz im thüringischen Schleiz hängt gegen Mittag ein klischeehafter Bratwurstgeruch. An parkenden Autos und auf T-Shirts sind ähnlich stereotype Botschaften zu lesen. So sieht stumme Lagerbildung in der Kleinstadt aus: „FCK PTN“ versus „Frieden schaffen ohne Waffen“ und „I love CO2“. Nur ein paar hundert Meter entfernt sind Ida S. und Michael Pape vor wenigen Minuten angekommen. Aus unterschiedlichsten Ecken haben sie sich auf den Weg gemacht – nicht nur übertragen auf die Region, auch mit Blick auf ihre Lebensrealitäten.
Ida S. ist Studentin und hat sich in der Klimabewegung politisiert. Nun leistet sie Basisarbeit für die Demokratie. Ihren Nachnamen aber möchte sie lieber für sich behalten. Pape ist Ingenieur, Familienvater, ehrenamtlich für eine lokale Gedenkstätte tätig. Einst war er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.
Was beide eint, ist ihr Engagement im Thüringer Hinterland: Im letzten Jahr hat Ida S. mit drei weiteren Personen ein Bündnis initiiert, das zur Gründung den Namen „Dorfliebe für alle“ bekam. Bald darauf war auch Michael Pape in das neue Netzwerk involviert. Denn bereits vor Veröffentlichung der Correctiv-Recherchen ist ihm und zunehmend mehr Menschen im Saale-Orla-Kreis bewusst geworden: Zeit sich zu vernetzen, Zeit genau dort gegen die AfD sichtbar zu werden, wo Widerspruch meist ausbleibt.

Das kurzfristige Ziel der Initiative beschreibt Ida S. so: „Es war klar, dass im Januar ein neuer Landrat gewählt und es voraussichtlich eine Stichwahl zwischen AfD und CDU geben wird. Und auch wenn wir bei der CDU nicht losjubeln, lag auf der Hand: Gegen die AfD müssen wir aktiv etwas machen, um zu verhindern, dass ein Kandidat außerhalb des demokratischen Spektrums in eine entscheidende politische Position kommt.“
So veröffentlichte das Bündnis einen offenen Brief mit Anti-AfD-Wahlappell, kurz darauf folgte eine Demonstration in Schleiz. Zu Beginn blieb die Zahl der Unterstützenden überschaubar. Vielleicht aus Angst, sich namentlich zu positionieren, vielleicht weil manche erst zu einer Haltung haben finden müssen, mutmaßt Michael Pape. Schließlich aber kommen mehr als 1 600 Unterschriften zusammen: von lokal Ansässigen im 80 000 Menschen fassenden Landkreis und auch von Unterstützenden aus dem Bundesgebiet.
An der Demo im Januar beteiligten sich rund 200 Leute. Wenige Wochen später setzte sich dann tatsächlich CDU-Kandidat Christian Herrgott in der Stichwahl gegen AfD-Kandidat Uwe Thrum durch. Mit 52 gegen 48 Prozent der Stimmen. Ein knappes, bei weitem kein klares Anti-AfD-Ergebnis.

Nach diesem Sprint der Mobilisierung kehrte zunächst wieder Ruhe ein. Durchatmen und inhaltlich ausrichten. Geplant ist, nachhaltige Strukturen für die Region zu schaffen und Selbstwirksamkeit zu vermitteln, „in dem Sinne, dass demokratische Mitbestimmung mehr bedeutet, als alle paar Jahre zur Wahl zu gehen“, meint Ida S. Vor den Kommunalwahlen hat ein gemeinsamer Austausch mit Interessierten stattgefunden, um politische Diskussionen nicht polarisierend, sondern konstruktiv zu führen.
Von Beginn an ist dem Bündnis ein Trumpf gewesen, Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, diverser Sozialisierung und Politisierung zu erreichen. So hätte „Dorfliebe für alle“ Breitenwirkung entfaltet, erklärt Pape: „Wir sind eben keine Untergruppe einer bestehenden Struktur, in der nur Menschen mit demselben Mindset unterwegs sind. Wir sind verschieden und überparteilich.“ Das bedeute in der Praxis Differenzen und Debatten. „In diesem kleinen Biotop ist es wie im Alltag: Wir müssen unterschiedliche Positionen aushalten und Kompromisse erarbeiten.“


Der Saale-Orla-Kreis gehört dabei zu den einkommensschwächsten in Thüringen. Abwanderung ist ein überpräsentes Thema. Was das bedeutet, weiß Ida S. aus eigener Anschauung. Vor etwa 15 Jahren hielt sie in der Grundschule einen Vortrag über ihr Heimatdorf. Damals wohnten noch 300 Menschen dort, heute sind es knapp über 200. Zwischen diesen Koordinaten scheinbar vergessener Landstriche mache sich schnell Mutlosigkeit breit, erklärt sie. In Gesprächen mit Menschen hört sie von „Unzufriedenheit und dem Gefühl, nichts ändern zu können. Das politische Selbstbild ist passiv“, fasst die Studentin zusammen. „Dabei ist doch diese Hoffnungslosigkeit das Schlimmste, was einer Demokratie passieren kann.“
„Wir müssen Positionen aushalten und Kompromisse erarbeiten.“
Untersuchungen des Thüringen-Monitors 2023 zeigen, dass knapp zwei Drittel der Menschen im Freistaat überzeugt sind, politisch einflusslos zu sein. Zudem korreliert der Studie nach eine Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Situation im Land auch mit einer Unzufriedenheit mit der Demokratie. Dieses Gefühl der Ohnmacht ermögliche laut Ida S., dass sich undemokratische, menschenfeindliche, rassistische Positionen zu konkreten politischen Einstellungen formen, weil Ideologien wie die der AfD einfache Antworten auf komplexe Probleme versprechen.
Und oftmals sind „Sündenböcke“ schnell ausgemacht – meist Menschen in ebenso prekären Lebenssituationen. Dazu passt ein Wert aus der jüngsten Analyse: 59 Prozent der befragten Menschen gaben an, die Bundesrepublik sei „in gefährlichem Maße überfremdet“.
Feindselige Aussagen gegenüber migrantischen Menschen und jenen mit muslimischem Glauben haben „deutlich mehr Zustimmung erfahren als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre“, lautet ein Ergebnis.


Passend zu diesen Befunden hätten sich bestimmte Narrative zum Osten längst manifestiert, meint Michael Pape. Vorschnell würde etwa von „Failed States“ gesprochen, „gescheiterte Staaten“, wenn es um die Zustimmung zu rechtsextremen Positionen, Demokratieskepsis oder -ablehnung geht.
„Ich denke an Begriffe wie ,Braunland’ oder ,Kaltland’. Das vernachlässigt komplett, dass es auch Leute gibt, die etwas tun. Wenn die, die Probleme benennen, die Bildungsangebote machen, die Austausch organisieren, nicht wahrgenommen und unterstützt werden, erhält das doch aber den Status Quo.“ Zur Wahrheit, meint er, gehöre jedoch auch, dass ein Großteil der Zivilgesellschaft zu spät aufgewacht ist. „Rückwirkend betrachtet haben wir die Entwicklungen seit 2015 weitgehend ignoriert. Hätte es da schon mehr Gegenrede gegeben, hätten wir bereits was bewirken können. Aber damals waren wir zu bequem, wir waren noch nicht an dem Punkt.“
„Rückwirkend betrachtet haben wir die Entwicklungen seit 2015 ignoriert. Wir waren damals zu bequem.“
Eine Frage, die das Beispiel „Dorfliebe für alle“ an dieser Stelle aufwirft: Wie finden Menschen in Dörfern oder kleineren Städten für eine gemeinsame, demokratische Positionierung zusammen? Dort, wo politisch polarisierende Themen in nachbarschaftlichen Gesprächen eher umschifft werden, um bei Unterschieden nicht direkt getrennte Wege zu gehen?

Der Sozial- und Rechtspsychologe Roland Imhoff hat diese Abwägung zwischen Auseinandersetzung und Ignoranz auf engstem Raum in einem Interview mal als „Burgfrieden“ bezeichnet. Gemeint ist damit, „sich darauf zu verständigen, sich als Mensch und Person zu schätzen, aber politische Themen ausklammern zu wollen“. Das dürfte vielerorts gelebte Praxis sein, wird aber insbesondere dort umso schwieriger, wo eine Gemeinschaft aus einer überschaubaren Anzahl an Menschen besteht.
Genau hier müssen rote Linien definiert werden, damit extreme Haltungen nicht „durchrutschen“, um der Harmonie Willen. Oder sich Menschen aus öffentlichen Räumen, von Veranstaltungen, Ehrenämtern zurückziehen, um potenziellen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Denn genau so entstehen letztlich Leerstellen beziehungsweise Einfallstore, die für die Verbreitung rechter Ideologien genutzt werden können.
In Regionen, wo noch dazu wenig organisierte Anlaufpunkte in puncto Demokratieförderung vorhanden sind, werden bereits etablierte Strukturen zu einem echten Notanker. Auch im Saale-Orla-Kreis. Kennengelernt und vernetzt haben sich Michael Pape und Ida S. nämlich auf einer Veranstaltung zum Thema „Erfahrungen mit Rechtsextremismus“.
Organisiert wurde der Workshop von der mobilen Beratung in Thüringen, kurz: Mobit. Der Verein wurde 2001 von der Jüdischen Landesgemeinde, dem DGB und der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland gegründet. Und genau über diese Bande spielt auch Romy Arnold eine entscheidende Rolle in der Erzählung des Engagements gegen rechts in Thüringen.

Von Erfurt aus arbeitet die Politikwissenschaftlerin seit 2019 für Mobit. Ihre Ost-Biografie führte relativ stringent zu diesem Punkt. Denn schon mit zwölf Jahren erfährt sie einen ersten prägenden Politisierungsmoment, erzählt sie.
Aufgewachsen in der Kleinstadt Arnstadt im thüringischen Ilm-Kreis hat sich ihr eine Begegnung nachhaltig eingebrannt: „Ich saß im Park und wurde von Nazis überfallen, wahllos bepöbelt und bespuckt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich gehöre optisch nicht zu deren Feindbild und ich war auch nicht in einer politischen Gruppe aktiv. Ich vermute, sie haben das gemacht, weil sie einfach eine gewisse Hegemonie in der Stadt hatten.“ Und was ihr in diesem Augenblick übrig bleibt: rennen!
Zunehmend wächst von diesem Punkt an ihr Bewusstsein für Politik. Romy Arnold beteiligt sich an ersten Demos gegen rechts, meldet später selbst Kundgebungen an. Sie vernetzt sich und bringt sich in politische Gruppen ein. Aus all diesen Erfahrungen heraus blickt sie heute durchaus dankbar und angespornt auf die neu entflammte Protestwelle im Land.
Wie in Schleiz auch, seien teilweise völlig neue Aktive aufs Spielfeld getreten. Für sie bedeute das Rückenwind: „Mir gibt das den Glauben zurück, dass das Potenzial der wehrhaften Zivilgesellschaft viel größer ist als angenommen.“
Überrascht habe Arnold dennoch, dass ein journalistischer Beitrag diesen Funken entfachen konnte. Denn natürlich hetzte Thüringens AfD-Chef Björn Höcke lange vorher öffentlich und wurde dafür von bejubelt statt geächtet. Der kollektive Aufschrei, die Mobilisierung blieb in etlichen Fällen aus. Unter anderem wegen strafrechtlich relevanter Äußerungen laufen mittlerweile mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Partei-Vorsitzenden.
Und selbst angesichts dieser Faktenlage wird Höcke auch gegenwärtig nicht von Parteien und Medien gemutet, sondern weiter aufs Podium gehoben – zuletzt bei einem TV-Duell mit Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt.

Worauf es für Romy Arnold ankommt? Dass sich vor allem CDU und FDP beziehungsweise die konservative Mitte abgrenzen und entschlossen mit zivilgesellschaftlichen, demokratischen Kräften solidarisieren. Nicht nur auf Anti-rechts-Demos, die verschiedenste Parteimitglieder genutzt haben, um Bilder zu produzieren. Sondern auch in der parlamentarischen Praxis.
Denn: „Engagierte können sich auf der Straße abkämpfen und noch so viel protestieren“, bemerkt Arnold, „letztlich sind Menschen in der Politik dafür verantwortlich, keine gemeinsame Sache mit der AfD zu machen.“
„Engagierte können sich abkämpfen, letztlich sind Menschen in der Politik verantwortlich, keine gemeinsame Sache mit der AfD zu machen.“
Der politische Alltag in Thüringen sieht längst anders aus. Gegen die rot-rot-grüne Regierung wurde im Herbst 2023 eine Steuersenkung mit Stimmen von CDU, AfD und FDP beschlossen. Und noch ein Beispiel hat 2023 gezeigt, wie instabil die vermeintliche Brandmauer manchmal ist: In Hildburghausen wurde zum Beispiel durch den Antrag von SPD, AfD und der rechtsextremen Wählervereinigung „Zukunft Hildburghausen“, Bürgermeister Tilo Kummer (Linke) nach fast drei Jahren aus dem Amt gewählt.
Das lasse nur einen Schluss zu, verdeutlicht Romy Arnold: Bis heute hätten es die Parteien verschlafen, sowohl parteiintern als auch -übergreifend, eine Haltung zu finden. Dabei gehe es nicht um einzelne kommunalpolitische Entscheidungen, sondern um eine klare Vorstellung, wie der Umgang mit einer extremen Rechten aussehen soll, die tatsächliche Machtoptionen hat.
„Das bräuchte es, um überhaupt wegzukommen von aus der Not geborenen Entscheidungen wie beispielsweise: ,Wir verzichten bei Wahlen auf unseren Kandidaten, unsere Kandidatin, um die AfD zu verhindern’. Das kann doch aus demokratietheoretischer Perspektive keine langfristige Antwort sein.“

Die Machtoptionen, die Romy Arnold hier für die AfD beschreibt, sind in Thüringen bemerkenswert. Laut Umfragen kommt sie auf 29 Prozent der Stimmen. CDU und BSW liegen deutlich dahinter. Die Partei überschreitet damit sogar ein vermeintliches Potenzial: Denn laut Thüringen-Monitor 2023 ordnen sich gegenwärtig 22 Prozent der Bevölkerung in Thüringen „weit rechts“ und „etwas rechts“ der Mitte ein. Seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2000 sei dieser Wert noch nie vergleichbar hoch gewesen.
Deshalb gelte es jetzt, einerseits deutliche Forderungen an die Politik zu richten und andererseits den entflammten Aktivismus der Zivilgesellschaft zu verstetigen. „Schau, wo du wirkmächtig bist“, appelliert Romy Arnold. „Und wenn es in Anführungszeichen nur deine Familie ist, dein Ehrenamt, dein berufliches Umfeld. Bring dich dort in die Diskussion ein.“
Diesen Rat gibt sie sich auch persönlich. Sollte die AfD mit der Landtagswahl Gestaltungsmacht erhalten, sei klar: „Wenn das Land die Mittel streicht und wir keine finanzielle Förderung mehr bekommen, dann werden Projekte wie Mobit nicht mehr existieren.“ Deswegen müsse jetzt alles getan werden, was überhaupt möglich ist, um das zu verhindern. „Es ist nicht zu spät“, ist Romy Arnold sicher. „Ich kann mir ohnehin keinen Zeitpunkt vorstellen, an dem es zu spät sein könnte für antifaschistisches Engagement.“
Brandenburg: Hotspot rechter Gewalt

In Potsdam steht ein Elefant im Raum. Als unsichtbarer Akteur schleicht sich die AfD in interne Diskussionen, Positionierungen, beeinflusst die Art und Weise des Außenauftritts des Vereins Opferperspektive in Brandenburg, der seit 1998 Betroffene rechter Gewalt und rassistischer Diskriminierung berät.
Manifestiert hat sich dieser Zustand 2021. Damals wurde klar, dass die Arbeit der Initiative essentieller Teil einer AfD-Diffamierungskampagne ist. Mit einer kleinen Anfrage stellten Andreas Kalbitz und Daniel Freiherr von Lützow damals etwa zur Debatte, inwiefern der Verein Verbindungen zur linksextremistischen Szene unterhalte.
„Es gab allgemein eine regelrechte Flut parlamentarischer Anfragen zu Projekten der Demokratiearbeit“, erklärt Geschäftsführerin Judith Porath. „Es ging darum, Angriffspunkte zu finden, um Fördergelder zu entziehen.“ Denn das ist erklärtes Ziel der Partei: Gelder für Demokratiestärkung und Extremismusprävention streichen. Für Menschen wie Judith Porath ist das ein bitterer Vorgeschmack auf das, was politische Gestaltungsmacht in Händen der AfD für ihre Organisation bedeuten könnte.
Die Antidiskriminierungsberatung des Vereins sei zwar über verschiedene Bundesprogramme finanziert, die Gewaltopferberatung allerdings zu 100 Prozent über Landesmittel, die wiederum zu einem großen Teil aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“ gespeist werden. Diese Gelder müssen also aktiv vom Land selbst angefragt und abgerufen werden.
Mit der bloßen Unterlassung ließen sich so vergleichsweise leicht Projekte austrocknen und stilllegen, Strukturen würden nachhaltig zerschlagen. Das könnte verheerende Konsequenzen für Betroffene rechter Gewalt nach sich ziehen – vor allem angesichts der Tatsache, dass laut Verfassungsschutz aktuell so viele rechtsextreme Menschen wie nie zuvor in Brandenburg leben. Und parallel dazu auch die Gewaltbereitschaft gestiegen ist.


Das Bundesland gilt dabei schon immer als Hotspot rechter Gewalt. Extrem rechte Bündnisse haben jedoch erst mit der Entstehung und Festigung der AfD realistische Optionen, um politisch Einfluss zu nehmen. Die Vernetzung zwischen der Partei und rechten Organisationen wie dem Cottbuser Verein „Zukunft Heimat“ ist bereits vielfach recherchiert.
Auf kommunaler Ebene gibt es zudem erste Koalitionen zwischen der AfD und der rechtsextremen NPD-Nachfolgeorganisation „Die Heimat“. Und so beherrscht vor der Wahl die Partei weiter den Austausch des 18-köpfigen Teams von Opferperspektive, meint Judith Porath.
„Die Überlegung wie wir uns äußern, begleitet uns stark. Und es nervt. Wir stehen vor der Frage: Wie sprechen wir in unserer Funktion als Initiative und Schutzorganisation für Betroffene rechter Gewalt? Und wie zeigen wir klare Kante und warnen vor der politischen Gefahr, die von der AfD ausgeht, ohne uns als einzige Anlaufstelle in der Region unnötig zu gefährden?“
„Wie warnen wir vor der politischen Gefahr, die von der AfD ausgeht, ohne uns unnötig zu gefährden?“
Mitglieder der Initiative tun das bei Kundgebungen in Städten wie Herzberg, Elsterwerda, Cottbus, Finsterwalde. Sie beteiligen sich mit Redebeiträgen an Demos und machen ihre Arbeit in der mobilen Beratung transparent, indem sie die Perspektiven derer teilen, die im Alltag Anfeindungen, Beleidigungen und Angriffen ausgesetzt sind – und sich oftmals alleine gelassen und nicht geschützt fühlen vonseiten der Polizei.
Dass diese manifesten Probleme nun auf Demos in kleinen Gemeinden und Städten zur Sprache gekommen sind, erlebt Porath als „Befreiungsschlag“: „Ich war vorher wie gelähmt und habe mich gefragt, was können wir noch machen, damit die Leute endlich interessiert, dass die Gesellschaft so stark nach rechts rückt?“ Sie macht klar: Wenn sich weiter neue Bündnisse finden, wenn sich Menschen einschalten, die vorher nicht zu sehen waren, ist das eine „großartige Chance“ für die Gesellschaft als Ganzes.

Diese Einschätzung teilt Nevena Mitic. Zwar unterstützt sie, dass Menschen auf die Straße gehen und sich neue Netzwerke bilden. Und trotzdem habe sie „innere Schwierigkeiten, sich von der Dynamik mitreißen zu lassen“, sagt sie. Persönlich und auch in der Funktion der Presseverantwortlichen, die sie bis Juli innehatte, beschäftige sie sich mit Rechtsextremismus, Rassismus, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und der AfD bereits seit Jahren.
Deshalb sei nichts an den veröffentlichten Themen neu oder überraschend für sie gewesen, zumal politische Gruppen und zivilgesellschaftliche Vereine unermüdlich auf diese Konflikte aufmerksam gemacht hätten. Ihr Eindruck: „Erst, wenn eine persönliche Betroffenheit und Torschlusspanik wie jetzt kurz vor den Landtagswahlen gegeben ist, gelingt es Menschen der weißen Mehrheitsgesellschaft, sich mit marginalisierten Gruppen zu solidarisieren.“
„Menschen sind weggezogen, weil sie Bedrohungen ausgesetzt waren.“
Nevena Mitic könne deshalb den Frust jener gut verstehen, die schon lange für Aufklärung eintreten und andere mobilisieren – ohne dass ihnen ähnlich viel Gehör geschenkt wurde. Sie unterstreicht aber auch, dass Brandenburg von der neuen Energie profitiere. Vor allem, weil mit Corona Engagement eingeschlafen ist: „Wir wissen von Menschen, die weggezogen sind, weil sie keinen Anschluss gefunden haben, weil sie Bedrohungen ausgesetzt waren. Gerade für die, die nicht weiß deutsch sind, ist es wichtig, über Netzwerke eine solidarische Gruppe, Austausch und Schutz zu finden. Das ist positiv.“
Das aktuelle Monitoring des Vereins drückt diese Dringlichkeit in Zahlen aus. Seit inzwischen 20 Jahren erfasst die Opferberatung systematisch rechte, antisemitische und rassistische Gewalt systematisch. Der Befund für 2023: „Die Zahlen sind erneut gestiegen. Menschen of Color, Schwarze Menschen, Geflüchtete, queere Personen – sie alle erleben regelmäßig Angriffe und Diskriminierungen. Die Situation ist wirklich beängstigend“, so Nevena Mitic.


Im letzten Jahr musste die Antidiskriminierungsberatung deshalb einen Aufnahmestopp ausrufen. Und auch in diesem Jahr sei das schon der Fall gewesen. Bemerkenswert ist, ein bislang unterschätzter Phänomenbereich rechter Gewalt gewinnt zunehmend an Bedeutung: „Betroffen sind sehr viele Kinder und Jugendliche. 45 Kinder zwischen von 0 bis 13 Jahren haben 2023 rassistische Gewalt erlebt. Das stimmt uns zutiefst besorgt.“ Und es spiegelt einen bundesweiten Trend wider. Der Angriffsort Schule müsse daher stärker in den Fokus rücken.
Um auf diesen blinden Fleck hinzuweisen, hat der Verein bislang zwei Fälle medial öffentlich gemacht. Im letzten Jahr berichteten zwei Lehrkräfte aus dem Städtchen Burg im Spreewald von rechtsextremen Parolen, Rassismus und Hitlergrüßen an ihrer Schule. Im Frühjahr beschäftigte dann ein Fall aus Cottbus die überregionalen Medien. Ein Lehrer soll gegenüber Schülern mit Fluchtgeschichte handgreiflich geworden sein. Berichten zufolge wurde ein syrischer Junge von dem Mann so heftig in den Nacken geschlagen, dass er ins Krankenhaus musste. Diagnose: Halswirbeltrauma.

Judith Porath vermutet ein hohes Dunkelfeld rechter Diskriminierung und Gewalttaten in Schulen, weil es sich um ein geschlossenes System, einen Sozialisierungs- aber auch Zwangsort handele, aus dem in der Regel wenig nach außen dringe. Heranwachsende sollen hier demokratisch gebildet werden, in dem Sinne, dass sie Auseinandersetzungen konstruktiv und auf Augenhöhe austragen. Wenn es Lehrpersonal wie Verwaltung nicht gelinge, Schule als Ort zu kreieren, der Schutz verspricht, könne das gravierende Auswirkungen auf individuelle Biografien haben, fasst sie zusammen.
„Wenn ich in der Schule attackiert werde und keine Möglichkeiten habe, mich zu entziehen, wenn ich keine Unterstützung bekomme, wird mich das mein Leben lang prägen und im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass ich daran zerbreche und keine Chance habe, meine Potenziale auszuschöpfen.“
Dass das neue Selbstbewusstsein rechter Angreifender wirkmächtig ist, unterstreicht ein Fall aus Heidesee, im Landkreis Dahme-Spreewald, der auf der Webseite von Opferperspektive dokumentiert ist:
„Jugendliche beleidigen Schüler*innen einer Berliner Schulklasse rassistisch. Nachts versammeln sich 30 von ihnen vermummt vor der Jugendherberge, schlagen gegen Türen und Fenster und bedrohen die Schüler*innen. Die Klasse muss daraufhin mitten in der Nacht abreisen.“
„Rechte Schläger fühlen sich in einem ohnehin aufgeheizten Klima in ihrem Handeln und ihrer Gewalt bestärkt.“
Diese Potenz junger Menschen mit rechten Einstellungen und Weltbildern beschreibt Nevena Mitic als traurige, aber logische Konsequenz. Was derzeit zu beobachten ist, sei die nächste Generation der Baseballschlägerjahre. „Rein strafrechtlich wurden Tatbegehende der Neunziger- und Nullerjahre nicht ausreichend zur Verantwortung gezogen. Und diese Straflosigkeit hat schließlich dazu geführt, dass sich rechte Schläger im ohnehin aufgeheizten gesellschaftlichen Klima in ihrem Handeln und ihrer Gewalt bestärkt fühlen.“
Von den „neuen Baseballschlägerjahren“ war jüngst im Zusammenhang von Übergriffen auf kommunalpolitisch Verantwortliche zu lesen. Für Betroffene marginalisierter Gruppen bedeuten diese Angriffe jedoch keinerlei Novum. Ihre Baseballschlägerjahre sind schon immer real, ihr Kampf ist einer ums Überleben. Dass es inzwischen eine größere Aufmerksamkeit dafür gibt, ist laut Porath dem Fakt geschuldet, dass sich Betroffene die gesellschaftliche Wahrnehmung hart erstritten haben. Dass nicht hingenommen wurde, dass Politik, Justiz und eine mehrheitlich weiße Zivilgesellschaft über Fehler und Gewalt hinweggehen – aus fehlender Betroffenheit.
Und es liegt auch daran, dass seit Jahren Menschen vor Ort sind, die diesen Widerstand unterstützen. Im sächsischen Zittau, inmitten von Thüringen, im ländlichen Brandenburg. Und in all den anderen Landstrichen im Osten, die Springerstiefel und Bomberjacken nicht als neues Normal sehen wollen.
Text: Melanie Skurt
Fotos: Karla Schröder (Sachsen), Iona Dutz, Dominique Wollniok (beide Thüringen) und Frederike van der Straeten (Brandenburg)
Illustrationen: Annika Keymer