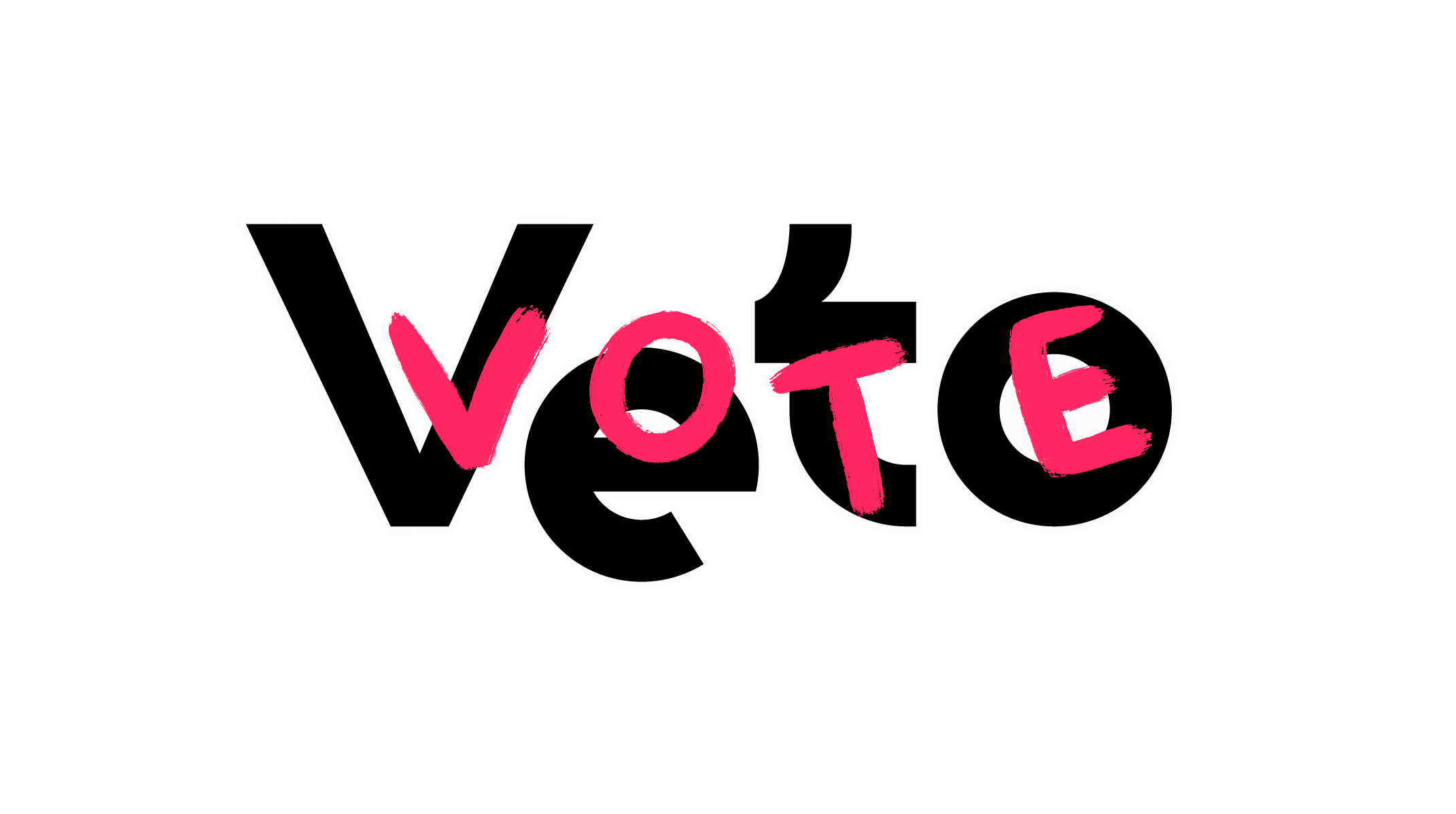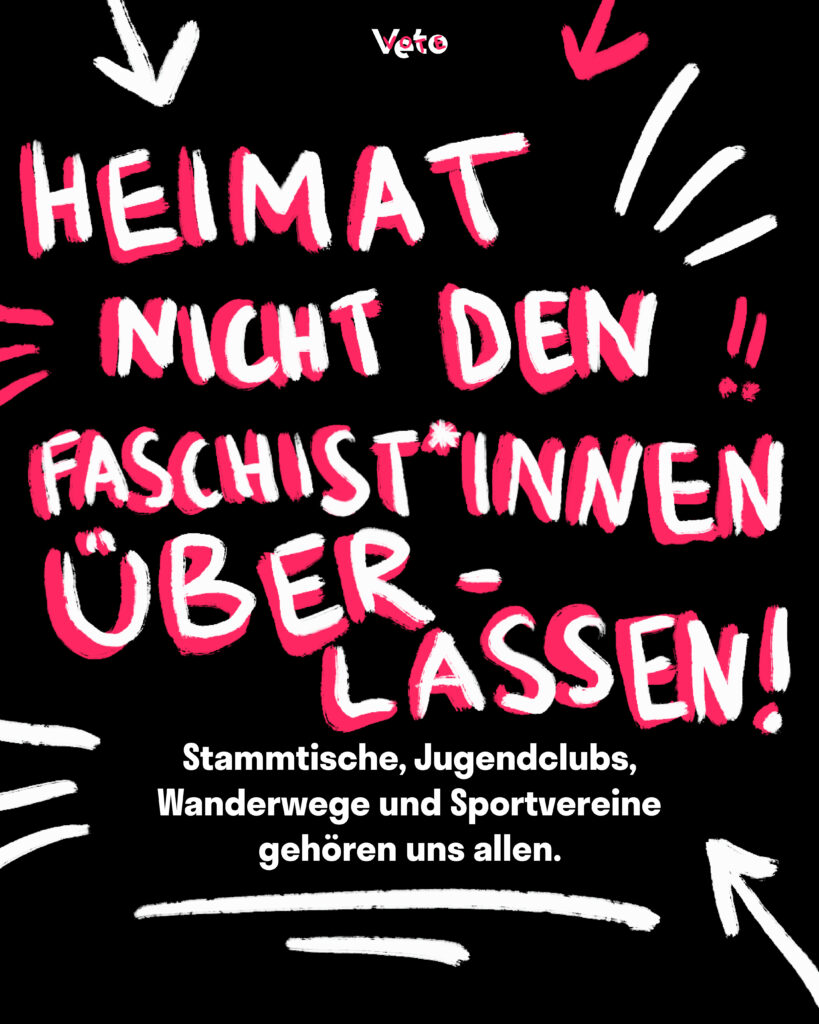Anti-rechts, wo es gefährlich ist
„‚Nazis raus‘ ruft es sich leichter, da wo es keine Nazis gibt” wusste schon die Band Kraftklub. Und trotzdem sind sie da: Menschen, die auch in Unterzahl gegen rechte Hetze aufstehen und dafür jeden Tag mit Konsequenzen rechnen müssen. Veto hat Engagierte in ihrem Einsatz gegen rechts in ostdeutschen Kleinstädten begleitet.
Inhaltswarnung: N-Wort und rechte Gewalt

Kahla in Thüringen, etwas mehr als 7 000 Einwohnende leben hier. Ein Café gibt es nicht, dafür ein AfD-Parteibüro – gelegen direkt neben einem Darts-Club, in dem sich abends Burschenschaftler betrinken. Ein Stück die schmale gepflasterte Straße runter steht ein Haus, das von stadtbekannten Neonazis als Treffpunkt gemietet wird.
Doch genauso wie diese rechten Strukturen gehören auch die Engagierten der Initiative AIS Saale-Holzland-Kreis zur thüringischen Kleinstadt. AIS steht für antifaschistisch, initiativ, solidarisch. Mit der Initiative bringen Franziska Reich, Franziska Kranzel und andere Menschen zusammen, die sich vor Ort für eine außerparlamentarische, linke Politik starkmachen wollen.
Reich ist von Beginn an dabei. Eine selbstorganisierte, linke Gruppe in einer Kleinstadt oder einem Dorf zu haben, das sei nicht selbstverständlich. Meist gebe es außerhalb der Parteien kaum Strukturen, um politisch aktiv zu sein. Franziska Reich und andere Gleichgesinnte wollten aus diesem Grund ein Angebot schaffen, bei dem alle jederzeit bedingungslos mitmachen können.

Franziska Reich, Sozialarbeiterin und Mitgründerin der Initiative „Antifaschistisch, Initiativ, Solidarisch“
AIS ist vor fünf Jahren entstanden. Um sich mit Aktiven in anderen Städten und Dörfern zu vernetzen, gibt es landkreisübergreifende Veranstaltungen. Zu den monatlich stattfindenden offenen Antifa-Treffs kommen mittlerweile zwischen 30 und 40 Menschen zusammen. Die Treffpunkte wechseln jedes Mal, um den Aufwand der Anfahrt gleichmäßig zu verteilen.
Inhaltlich geht es um den Kampf gegen eine zunehmende Einflussnahme von Rechtsaußen, aber vor allem auch um eine emanzipatorische Politik. In den letzten Jahren fanden zum Beispiel ein queerfeministisches Festival mit dem Namen Kahla Courage und zahlreiche Demos statt.

Franziska Kranzel ist Lehmbauerin, Restauratorin und studiert nebenher soziale Arbeit
Die großen Demonstrationen nach den Correctiv-Enthüllungen haben Reich und Kranzel als entlastend und erleichternd wahrgenommen. Sie benennen es als einen besonderen Moment, als sich plötzlich auch in Kleinstädten wie Kahla etwa 100 Menschen zu Protesten gegen die AfD zusammenfanden.
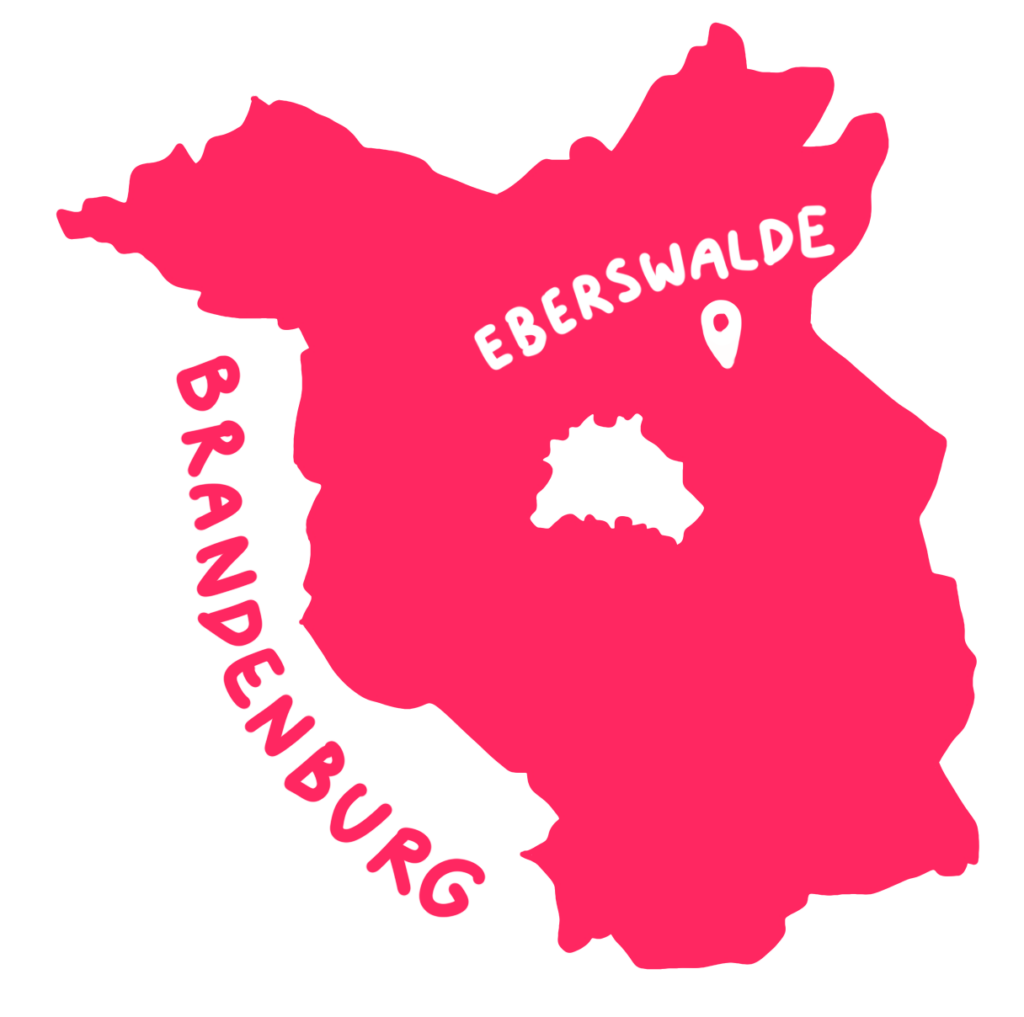
Amadeu Antonio war eines der ersten Todesopfer rechter Gewalt nach der Wiedervereinigung. Er wurde am 24. November 1990 von Rechtsextremen mit Baseballschlägern und Zaunlatten bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt. Als er bereits regungslos am Boden lag, sprang einer der Angreifer mit den Füßen auf seinen Kopf. In den darauffolgenden elf Tagen lag er im Koma und erlangte nie wieder das Bewusstsein. Am 6. Dezember starb Amadeu Antonio an multiplem Organversagen – zweifellos eine unmittelbare Folge der Attacke. Es ist einer der extremsten Fälle von vielen in der Region.
Angst vor Gewalt und rechtem Terror gehörten für Augusto Jone Munjunga und andere Schwarze Menschen in den Neunzigern zum Alltag – gerade in ostdeutschen Kleinstädten. Um sich zu schützen, hätten sie sich abends nur noch in Gruppen auf die Straße getraut, erinnert sich Munjunga.

Augusto Jone Munjunga ist Mitbegründer und Vorsitzender des afrikanischen Kulturvereins Palanca
In seinen ersten Jahren in Deutschland erlebte Munjunga ein Eberswalde ohne migrantische Organisationen. In Restaurants oder Bars zu gehen, sei gefährlich gewesen, weil Schwarze Menschen dort nicht willkommen waren, erinnert er sich. Diskotheken habe es überhaupt nicht gegeben. Stattdessen sahen sich Munjunga und seine Verbündeten in ihre privaten vier Wände zurückgedrängt. Die Stimmung, der sie draußen ausgesetzt waren, erlebten sie nicht nur als Rassismus, sondern als Krieg.
Aus dieser beängstigenden Situation heraus entstand die Idee, einen Ort zu schaffen, an dem sich People of Colour, Punks und Linke sicher fühlen und austauschen können. Also gründete Augusto Jone Munjunga mit anderen Vertragsarbeitenden den afrikanischen Kulturverein Palanca – benannt nach einer Antilope, deren Kopf in Angola als nationales Symbol gilt.
Anfangs öffneten Palanca und die anderen die Türen des Vereins vor allem für Partys und Konzertabende. Aufgrund fehlender Konkurrenz habe sich der Verein damals schnell zur angesagten Partylocation für junge Menschen entwickelt. Munjunga bezeichnet diesen Erfolg als „gelungene Integration“.
Heute jedoch liegt sein Fokus nicht mehr auf kulturellen Veranstaltungen. So mietet Munjunga unter anderem Wohnungen an, um sie Menschen mit Fluchtgeschichte ohne Aufenthaltstitel zur Verfügung zu stellen. Außerdem sammelt er Daten zu rassistischen Vorfällen im Landkreis Barnim.
Der Verein ist auch Anlaufstelle für Frauen mit Migrationsgeschichte, bietet Informationen zu Sprachkursen oder Aufenthaltsrecht. Beteiligt ist Augusto Jone Munjunga genauso an der jährlichen Gedenkveranstaltung „Light me Amadeu“, um an seinen Freund und Kollegen zu erinnern.
„Wir, die Überlebenden, sollen einfach gehen? Aus Angst? Nein! Wir bleiben hier, bis der Letzte stirbt.“
Dass People of Colour in Eberswalde heute nicht mehr Angst haben müssen, wenn sie einkaufen oder in ein Restaurant gehen, ist Menschen wie ihm zu verdanken. Menschen, die trotz allem geblieben sind und die sich auch nicht haben vertreiben lassen – und stattdessen Räume für Entfaltung schaffen.
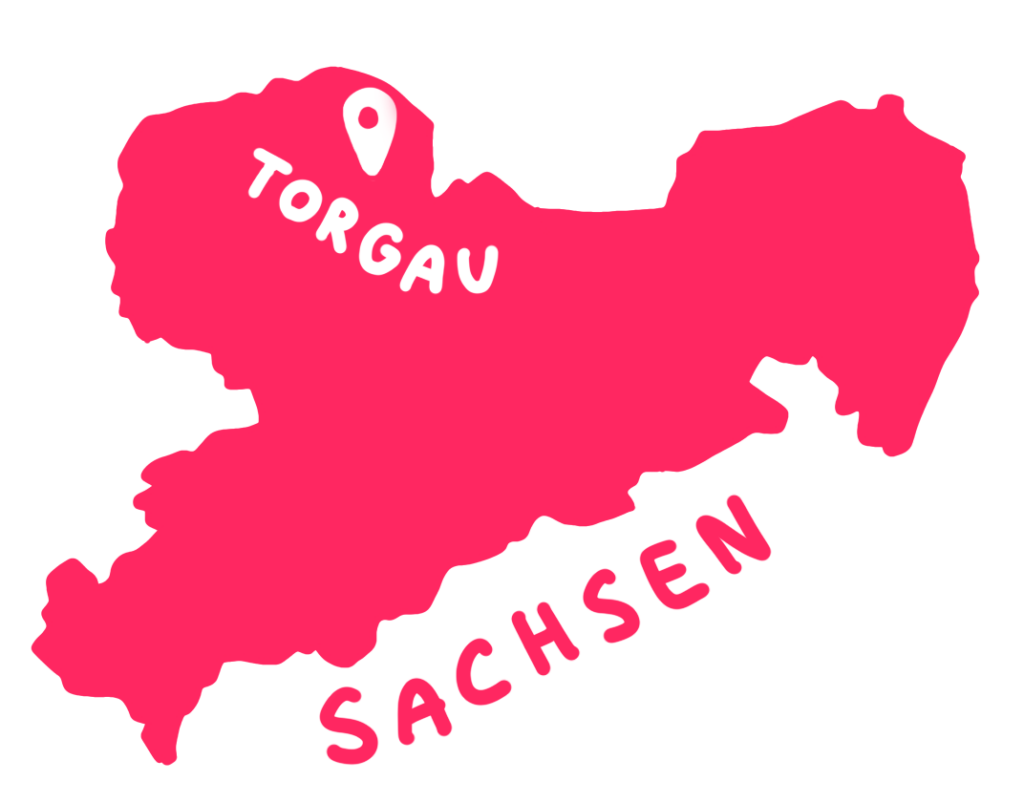
Das Aufwachsen als linker Aktivist in Zwickau beschreibt Jakob Springfeld in seinem Buch „Unter Nazis“, das zusammen mit einem Journalisten entstand. Die Geschichten aus dieser Zeit teilt er seitdem überall im Land – und ist so zu einer der viel gehörten jungen, ostdeutschen Stimmen geworden.

Jakob Springfeld liest regelmäßig aus seinem Buch „Unter Nazis“ und spricht auf Demos
Für Springfeld spielten politische Kategorien wie links und rechts lange Zeit überhaupt keine Rolle. Sein politisches Bewusstsein entwickelte sich, als er sich mit einem Menschen anfreundete, der aus Afghanistan geflohen war und in Zwickau extremen Anfeindungen ausgesetzt war.
Und weil es keine lokale Antifa-Gruppe gab und das Klima-Thema präsent war, gründete er mit einer Freundin einen Zwickauer Ableger von Fridays for Future. Was schließlich dazu führte, ins Visier von Neonazis zu geraten.
Die Prognosen für die Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im Herbst 2024 sind allgegenwärtig – und die düsteren Szenarien, in denen die AfD stärkste Partei werden könnte, laden dazu ein, diejenigen, die dagegen halten, zu heroisieren. Jakob Springfeld schreibt in seinem Buch: „Ich will kein Held sein – schon gar nicht im falschen Film.“ Immer wieder werde er bei seinen Lesungen beklatscht und beglückwünscht. Es reiche aber längst nicht aus, meint er, sich dafür auf die Schulter zu klopfen.
„Ich könnte meine Klappe halten, mich dem Visier von Neonazis entziehen. Andere Menschen, die von Rassismus betroffen sind, können das nicht.“
Springfeld will Leute zusammenbringen und zeigen, dass es „keine Person alleine reißen wird“. Zum anderen wird der Aktivist nicht müde zu betonen, dass er nur eine Perspektive gegen rechts von vielen einnimmt. Es gebe so viele andere, die mit weniger Ressourcen und Privilegien ausgestattet seien, was durch den Fokus auf ihn als Einzelperson droht, vergessen zu werden.
Linke Engagierte in ländlichen Strukturen seien sehr viel schneller rechter Gewalt ausgesetzt, mahnt Jakob Springfeld. Gleichzeitig gebe es auch in Zwickau Räume, um sich zivilgesellschaftlich zu organisieren. Und genauso gibt es hoffnungsvolle Momente – zum Beispiel, dass an Jakob Springfelds ehemaliger Schule der NSU-Komplex heute fest zum Lehrplan gehört. Noch als Schüler hatte er lange für eine solche Aufarbeitung gestritten.
Text: Jasper von Römer
Fotos und Videos: Karla Schröder und Sebastian Winterscheid
Illustration: Karla Schröder