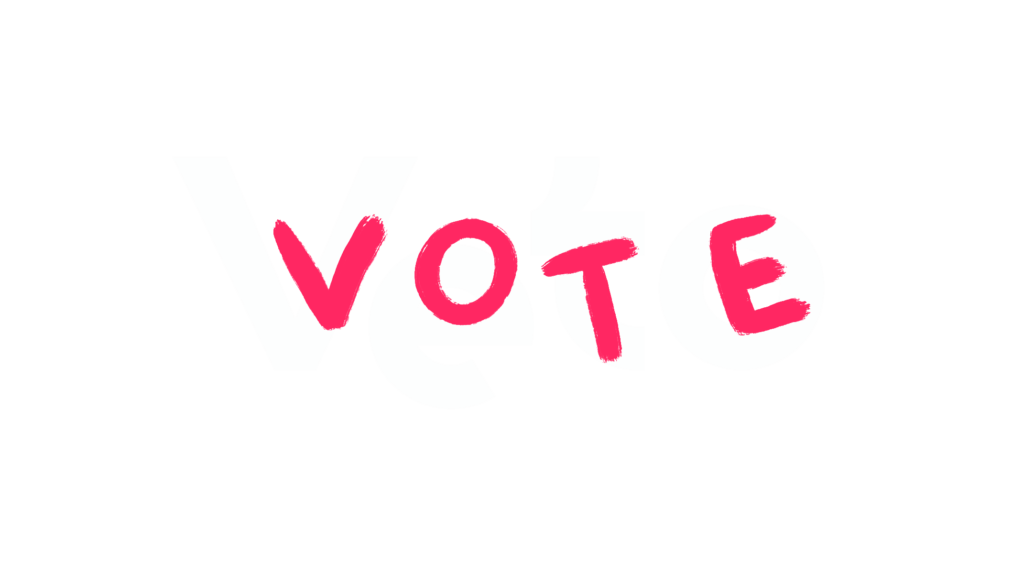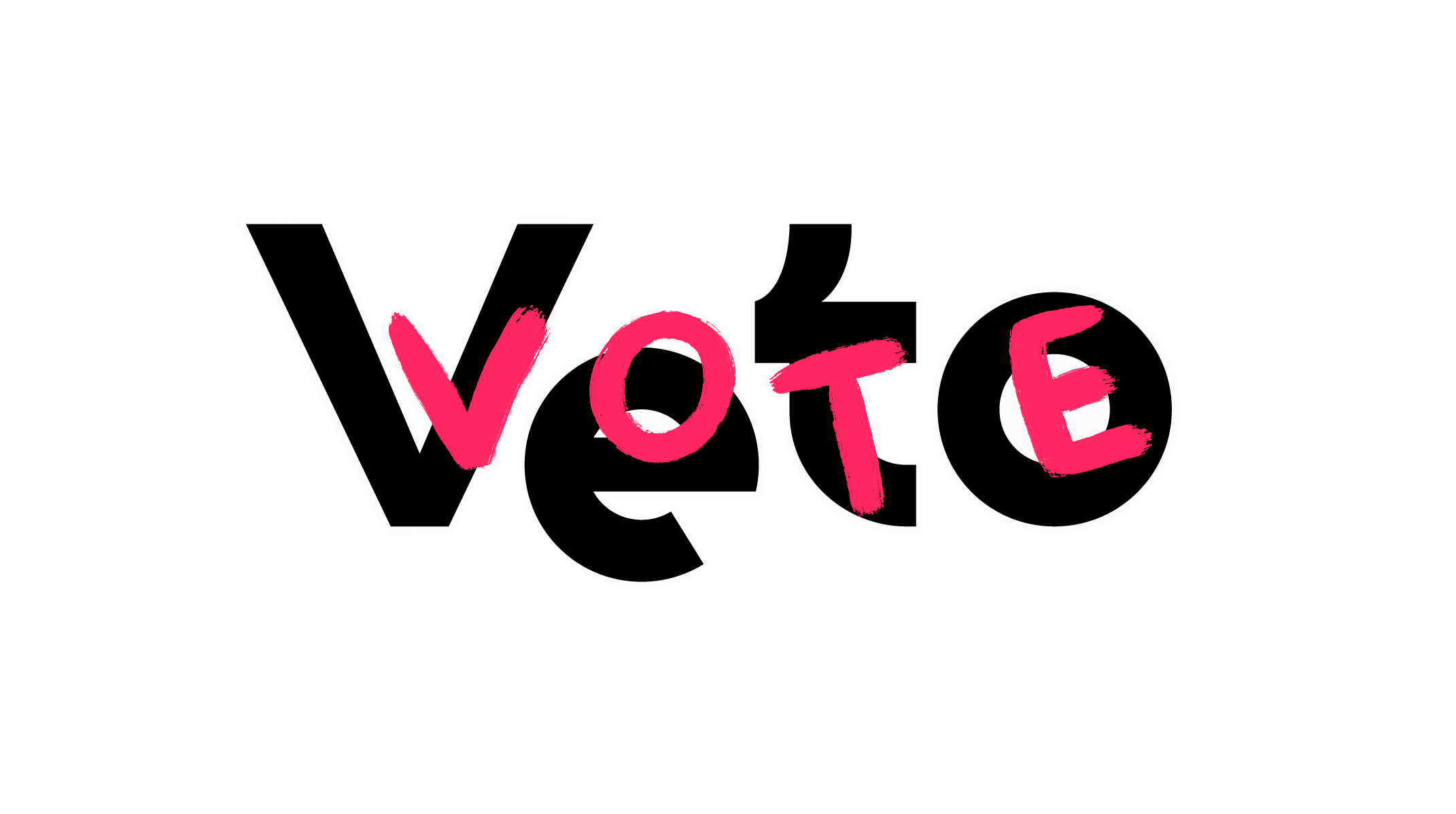Fatima Maged ist 28 und lebt bereits seit 26 Jahren in Chemnitz. Sie hat Medienmanagement in Mittweida studiert. Heute leitet sie die Redaktion „SpeakOutL_out“ des freien Radios in Chemnitz und steht außerdem dem Internationalen Zentrum für Demokratie und Aktion vor.
Ich fühle mich angesprochen, wenn die AfD von „Remigration“ spricht, auch wenn ich eine deutsche Staatsbürgerschaft habe. Schon mein Aussehen wäre nach dem Weltbild dieser Leute nicht deutsch genug. Und jemand wie mein Bruder – ein junger, arabisch gelesener Mann Anfang 20, der sehr laut und euphorisch sein kann – würde noch schneller dazugezählt werden.
Auf den würden sie zeigen und sagen, dass er für all das steht, was in der Flüchtlingspolitik schiefläuft. Und wenn es machbar wäre, würden sie uns abschieben. Ja, vor dieser menschenverachtenden Haltung habe ich Angst.
Aber dann denke ich: Wenn sie uns alle abschieben würden, dann wäre dieses Land am Arsch. Dann würden unsere Wirtschaft, unser Sozialsystem, unser ganzes Miteinander anders aussehen. Die AfD-Leute wären die ersten, die uns anrufen und sagen würden, wir sollen doch bitte zurückkommen.

Das Gerede von „Remigration“ ist nichts als Propaganda. Natürlich gibt es auch unter Geflüchteten problematische Menschen, aber die AfD tut so, als wären alle gleich. Problematische Menschen gibt es doch in jedem Land. Und natürlich sind jene stärker gefährdet, die von Anfang an Rassismus, Diskriminierung und Abwertung erfahren mussten.
Gleichzeitig sind viele Geflüchtete überfordert, sie kennen das System nicht. Schüler*innen werden in Haupt- oder Förderschulen gesteckt, weil sie die Sprache nicht gut sprechen, aber aufgrund ihrer Intelligenz würden sie eigentlich an eine Realschule oder ein Gymnasium gehören.
Menschen, die Krieg und Flucht erlebt haben, bekommen außerdem keine psychologische Betreuung – einfach, weil es auch da eine Sprachbarriere gibt. Eigentlich müssten wir viel deutlicher zeigen, dass all das die Folgen einer geldgeilen und rassistischen Asyl- und Flüchtlingspolitik sind. Aber stattdessen werden die Opfer zu Täter*innen gemacht.
Die AfD fragt auch überhaupt nicht, warum die Menschen hier sind und wie lange sie schon da sind. Es ist etwas ganz anderes, ob jemand gerade hier angekommen ist oder ob die Eltern vielleicht als Vertragsarbeiter*innen gekommen sind. Es ist denen egal, ob die Leute zurück könnten oder ob sie hier aufgewachsen sind. Meine jüngeren Geschwister nennen sich Deutsch-Libanesen, sie sind hier geboren und mit beiden Kulturen aufgewachsen.


Mein Engagement ist eine Reaktion auf den ewigen Satz: „Schön, dass Leute wie du auch hier sind.“ Ich habe mir das nicht selbst bewusst ausgesucht – ich wurde dahin geschoben. Ich habe Diskriminierung erfahren: wegen meiner Behinderung, wegen meiner Herkunft, wegen meines Aussehens. Damit war ich in diesem Land sehr früh konfrontiert.
Ich habe schon in der Mittelschule mit Menschen darüber diskutiert, was Rassismus ist, was Diskriminierung ist – und warum das alles unsinnig ist und wir differenziert auf die Dinge schauen müssen. In der Mittelschule war ich ein junger Mensch, der Probleme hatte mit der Pubertät oder mit Liebeskummer oder mit der Frage, wer mit mir befreundet sein möchte.
Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug gewesen, musste ich auch immer mit Leuten diskutieren und Dinge erklären. Und das ist ja bis heute längst nicht zu Ende. Seit ich denken kann, reden wir darüber, dass Nazi-Deutschland sich nicht wiederholen darf. Aber gefühlt hat sich am System nichts verändert, auch wenn im Januar und Februar viele Menschen demonstriert haben. Also habe ich nicht wirklich eine Wahl, als mich zu engagieren – und das auf vielen verschiedenen Ebenen.

Wie es mir damit geht, ist tagesformabhängig. Im letzten Oktober wollte ich alles hinschmeißen. Ich habe gesagt, dass ich nicht mehr weitermache. Aber dann wusste ich, ich muss weitermachen.
Ob das Spaß macht? Eins meiner Projekte ist das Internationale Zentrum für Demokratie und Aktion. Dort war ich neulich im Gespräch mit einer Person – und ich habe gesehen, wie draußen jemand absichtlich Hundekacke in unsere Richtung geworfen hat. Ich konnte das Gespräch nicht abbrechen, um diese Leute zur Rede zu stellen. Sowas macht keinen Spaß.
Was mir Freude macht, ist meine migrantische Redaktion, bei der es darum geht, Migrant*innen zu empowern, damit sie selbst Radio machen können. Auch meine Kunstprojekte und der Rollstuhlsport machen mir Freude.
Und dann gibt es ein Projekt, bei dem ich zusammen mit Migrant*innen deren Lebensgeschichte aufschreibe. Daraus sind bis jetzt 20 Geschichten entstanden, die sehr viel gemeinsam haben. Diese Menschen haben so viel durchgemacht, haben so viel Diskriminierung und Rassismus erfahren.
Und dann werden sie von der Politik in einen Topf geworfen und ihnen wird das Leben schwer gemacht. All das macht mir Spaß, es macht mich wütend, es macht mich traurig. Aber manchmal macht es mir auch Hoffnung.
Text: Fatima Maged
Fotos: Maximilian Gödecke