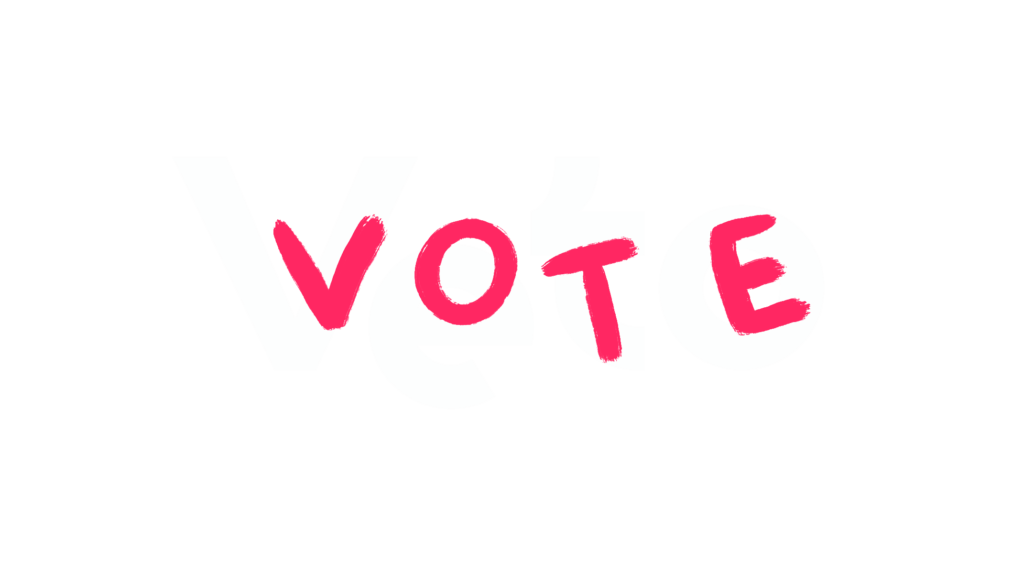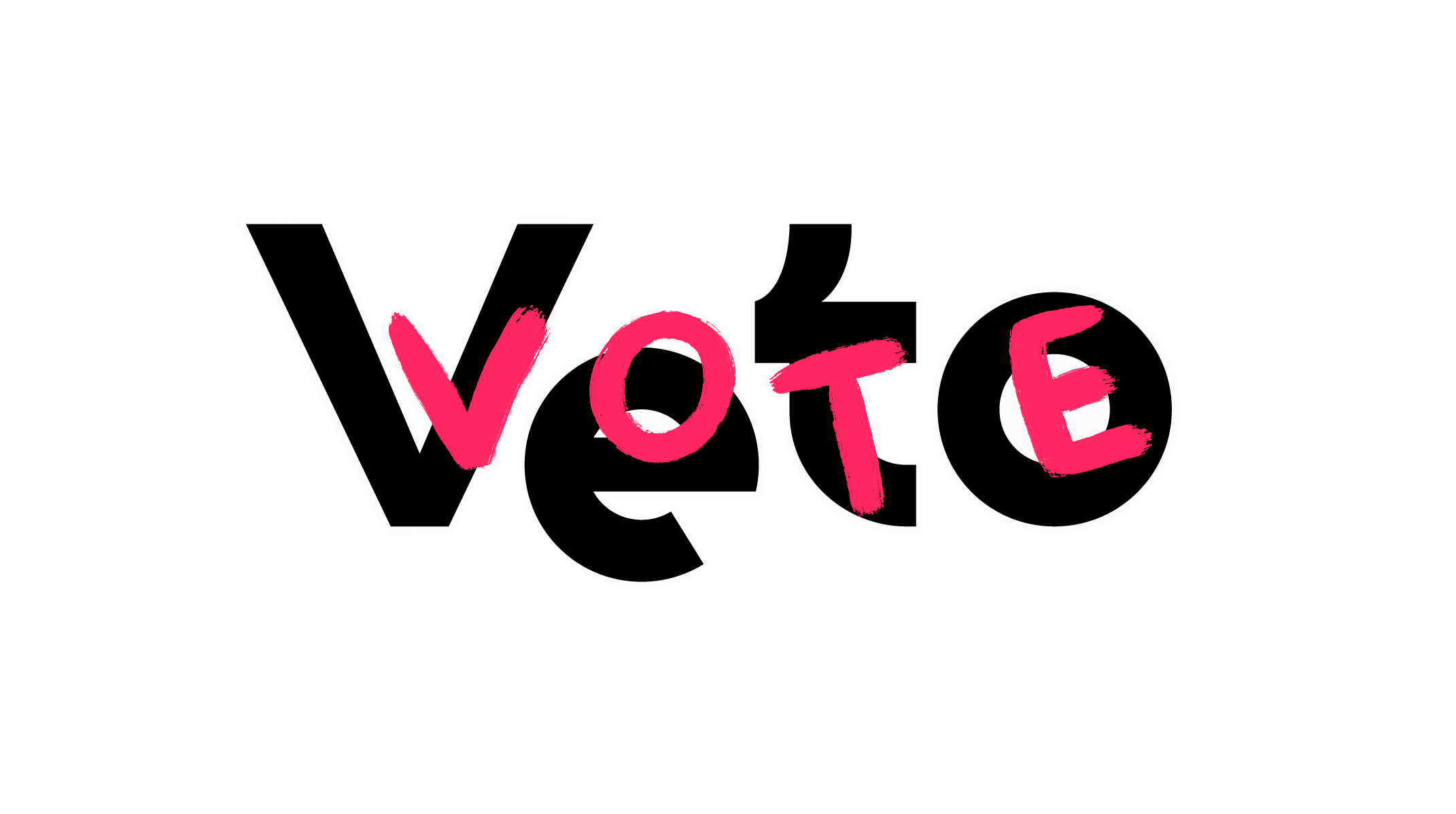Esat Al-Hakim* kam 2015 aus Syrien nach Deutschland. Weil er einen neuen Job angefangen hat, möchte er nicht erkannt werden, wenn er sich politisch äußert: Das sei in Sachsen unter Umständen zu riskant.
Was es mit mir macht, wenn die AfD erklärt, dass Menschen Deutschland verlassen sollen, weil sie entweder keinen deutschen Pass haben oder weil sie nicht deutsch genug sind? Um das zu beantworten, muss ich ein wenig ausholen. Ich bin nicht hier geboren. Ich bin vor ungefähr neun Jahren nach Deutschland gekommen, geflüchtet aus Syrien.
Es hat lange gedauert, bis ich die politische Lage verstanden habe. Solche Aussagen lösen in mir das Gefühl aus, dass die Geschichte sich wiederholen wird. Mein Eindruck ist, dass gerade alles wieder auf der Kippe steht.
Als ich in Deutschland angekommen bin, hat das mit Pegida begonnen. Ich habe die Demos gesehen, aber von Anfang an nicht gecheckt, was das ist. Jetzt sind fast zehn Jahre vergangen und ich sehe diese Leute immer noch jeden Montag. Ich weiß, das sind Menschen, die nicht akzeptieren wollen, dass ich hier existiere. Es gibt viele nette Menschen hier, aber es gibt auch viele andere, die in ihrer Ablehnung sehr konsequent sind.

Natürlich stellt sich da für mich immer wieder die Frage der Zugehörigkeit. Damit kämpfen Geflüchtete dauernd. Bei mir kommt direkt der Gedanke: Ich werde niemals wirklich hierher gehören. Ich lebe in Sachsen, wo die AfD die stärkste oder zweitstärkste Partei ist. Da fühle ich mich sowieso nicht willkommen und bei gewissen Aussagen frage ich mich wirklich, ob ich hier bleiben soll und kann. Aber: Die AfD ist ja nicht nur in Sachsen so stark.
Ich bin Stadtplaner, mein Job orientiert sich also an deutschen Gesetzen. Da habe ich nicht wirklich Alternativen. Ich kenne viele Menschen, die Sachsen verlassen wollen, weil sie sich hier nicht wohlfühlen. Rassismus ist einfach deutlich spürbarer als woanders. Gleichzeitig stelle ich mir auch die Frage, ob ich nicht hier bleiben muss. Denn wenn wir alle bleiben, dann würde es ja vielleicht irgendwann viel schöner und besser werden. Aber wer will das für sich in Kauf nehmen, so lange durchzuhalten?
Ich sehe auch, dass wir in einem echt schwierigen Umfeld leben, wenn es um Engagement geht. Vor allem Leute aus dem linken Spektrum haben es sehr schwer. Ich versuche Kunstprojekte umzusetzen, um etwas zu bewegen – und es ist quasi unmöglich, dafür an Geld zu kommen. Die Politik, vor allem auf der kommunalen Ebene, tut sich da sehr schwer.

Wir sollten alle achtsamer miteinander sein. Wir müssen sensibler werden. Ich denke, das passiert automatisch, wenn wir miteinander Kontakt haben, Räume teilen. So können die Grenzen zwischen uns langsam verschwinden.
Damit das gelingt, müssen wir auch (mehr) über Rassismus sprechen. Ich finde es sehr schade, dass rechtsextreme Parteien es in den letzten Jahren geschafft haben, den Diskurs in Deutschland stark zu verschieben.
Und wenn Übergriffe wie der auf Matthias Ecke passieren, ist eigentlich klar, dass niemand hier wirklich sicher ist. Ich fürchte mich zwar nicht, allerdings überlege ich mir manchmal zweimal, ob ich öffentlich auftrete – mit Namen und meinem Gesicht. Ich komme aus Syrien, einem sozialistischen Land, in dem keine Demokratie herrscht. Damals hatte ich solche Gedanken ständig. Dass ich sie jetzt hier wieder habe, finde ich schade.
* Name von der Redaktion geändert
Fotos: Maximilian Gödecke